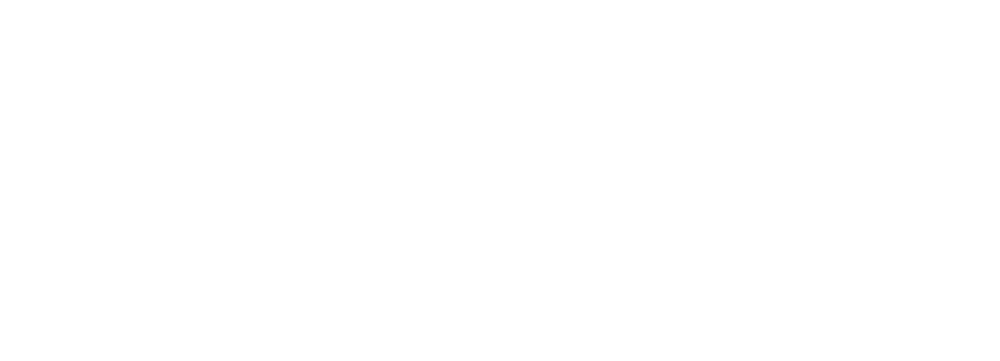Aktuell erreichen nur 50% der Kinder mit rheumatischen Erkrankungen dauerhaft eine Krankheitsfreiheit. Unser Ziel ist es, die Erkrankung heilbar zu mach. Es gibt Beispiele, wie schwer- oder nichtbehandelbare Erkrankungen bei Kindern besser therapiert werden können....