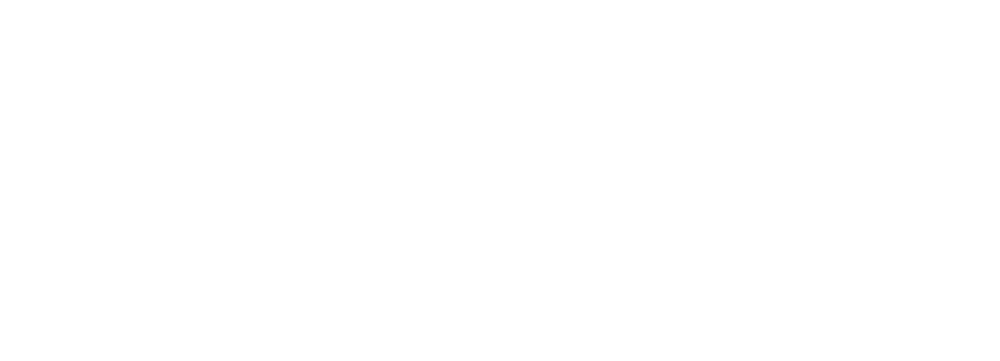Der Welttag der jungen Rheumapatienten findet jährlich am 18. März statt und rückt die Herausforderungen junger Menschen mit rheumatischen Erkrankungen in den Fokus. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass Rheuma nur ältere Menschen betrifft, kann diese Krankheit Menschen jeden Alters treffen. Der Aktionstag zielt darauf ab, das Bewusstsein für die spezifischen Bedürfnisse junger Rheumatiker zu...
Blog
Kerndokumentation rheumakranker Kinder und Jugendlicher
Rheuma bei Kindern und Jugendlichen hat viele Gesichter, über 100 verschiedene Erkrankungen sind bekannt. Die meisten Erkrankungen sind selten, alle bergen das Risiko dauerhafter gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Um eine optimale Erkennung und Behandlung betroffener Kinder und Jugendlicher zu gewährleisten, ist eine detaillierte und kontinuierliche Erfassung von Krankheitsverläufen notwendig. Das ist die Aufgabe der Kerndokumentation. Die...
Ausschreibung 2025 – Förderung eines Projektes zur Diagnostik bei Verdacht auf Autoinflammation
Die Kinderrheuma Stiftung Sabine Löw fördert wissenschaftliche Arbeiten zur Erforschung der Entstehungsgrundlagen, der Verlaufsbedingungen, der Krankheitsfolgen, der Diagnostik und der Behandlung rheumatischer Erkrankungen, hier insbesondere mit dem Ziel der Verbesserung der Behandlungsmö glichkeiten fü r Kinder mit rheumatischen Erkrankungen, durch Projektbeihilfen. Dank einer großzügigen Spende durch Sobi Swedish Orphan Biovitrum GmbH kann die Stiftung...
Ausschreibung 2025 – Förderung eines Pilotprojektes
Die Kinderrheuma Stiftung Sabine Löw fördert wissenschaftliche Arbeiten durch Projektbeihilfen mit dem Ziel, die Behandlungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche mit rheumatischen Erkrankungen zu verbessern. In diesem Jahr schreibt die Stiftung erneut ein Pilotprojekt zur Förderung aus. Thematisch soll es um die Erforschung der Entstehungsgrundlagen, der Krankheitsfolgen, der Diagnostik oder der Behandlung rheumatischer Erkrankungen gehen....
Lehrvideos in der Pädiatrischen Rheumatologie!
Ein Schritt zur Verbesserung der Versorgung von Rheuma bei Kindern Wussten Sie, dass rund 20.000 Kinder und Jugendlichen in Deutschland an Rheuma leiden? Die chronische Gelenkentzündung (juvile idiopathische Arthritis = JIA) beeinflusst die gesamte kindliche Entwicklung. Daher benötigen die kleinen und großen Patienten sowie ihre Familien Informationen darüber wie wichtig eine frühzeitige Diagnose ist....
Eröffnungsveranstaltung der Löw-Stiftung beim Kongress für Kinder- und Jugendmedizin in Berlin 2021
...
Biosampling Pro-Kind
ProKind-Rheuma: Ein Meilenstein in der Behandlung von Rheuma bei Kindern Rheumatische Erkrankungen bei Kindern sind selten, aber sie stellen sowohl für die betroffenen Familien als auch für die medizinische Gemeinschaft eine große Herausforderung dar. Während die Forschung und Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahren Fortschritte gemacht haben, bleibt die individuelle Anpassung der Therapie eine der...
Infektanfälligkeit bei Kindern und Jugendlichen mit rheumatischen Erkrankungen
Eine wichtige Studie! Kinder und Jugendliche mit rheumatischen Erkrankungen sind häufig einer höheren Infektanfälligkeit ausgesetzt. Dies betrifft vor allem Kinder, die mit immunsuppressiven Medikamenten behandelt werden. Während es für Erwachsene bereits viele Informationen zu diesem Thema gibt, fehlen für Kinder und Jugendliche noch genaue Daten. Genau hier setzt eine Studie des Universitätsklinikums Freiburg unter...
Unsere Mission: Kinderrheuma besiegen!
Aktuell erreichen nur 50% der Kinder mit rheumatischen Erkrankungen dauerhaft eine Krankheitsfreiheit. Unser Ziel ist es, die Erkrankung heilbar zu mach. Es gibt Beispiele, wie schwer- oder nichtbehandelbare Erkrankungen bei Kindern besser therapiert werden können....
Sabine Löw und der Zweck ihrer Stiftung
Frau Dr. Sabine Löw hatte erkannt, dass rheumatische Erkrankungen im Kindesalter einen erheblichen Einfluss auf Patienten und ihre Familien haben. Es war ihr Wunsch ihrem Besitz nach ihrem Tod der kinderrheumatologischen Fachgesellschaft (GKJR) zu stiften. „Tun sie mit der Stiftung etwas für eine bessere Behandlung und eine bessere Zukunft rheumakranker Kinder.“ ...